2006 – Guerra in Libano
Ancora una volta gli avvenimenti nel Vicino Oriente si accavallano e non per il meglio. Aerei israeliani bombardano i sobborghi di Beirut e anche l’autostrada fra la capitale libanese e Damasco è chiusa al traffico. La marina israeliana ha sigillato le vie di accesso marittime al Libano. Come contromossa la milizia sciita Hezbollah spara missili sempre più in profondità nell’entroterra di Israele – gli ultimi fin dentro la città portuale di Haifa.

Mentre il conflitto militare si inasprisce, il tono dei responsabili governativi coinvolti diventa sempre più tagliente. Il primo ministro d’Israele Ehud Olmert parla di una dichiarazione di guerra del Libano, il cui governo non ferma gli Hezbollah. Il presidente iraniano Akhmadinejad mette in guardia Israele dall’aggredire la Siria e minaccia severe reazioni. Nella capitale siriana sia gli Hezbollah che il movimento islamico palestinese Hamas hanno la loro centrale. Incombe una guerra regionale. Dove stanno le cause di questo conflitto che ormai da sessant’anni non si placa? Una visione d’insieme storica.
1947 – Un piano di ripartizione dell’ONU
Dopo lunghe, turbolente trattative l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite mette ai voti9 una risoluzione per la ripartizione del territorio palestinese sotto mandato britannico. Nella Risoluzione 181 dell’ONU si dice letteralmente: “Due mesi dopo il ritiro delle forze armate della Potenza mandataria e in ogni caso non più tardi del 1 ottobre 1948 devono esistere Stati indipendenti, arabo ed ebreo, nonché un Regime Internazionale Speciale per la città di Gerusalemme e il suo distretto. I confini dello Stato arabo e di quello ebreo e quelli della città e distretto di Gerusalemme devono fissarsi come prescritto oltre nella parte II e III.” La Risoluzione dell’ONU regolava non soltanto l’esatto percorso delle frontiere, ma anche le cittadinanze, le vie di transito, i diritti religiosi e civili. I governi arabi e i Palestinesi rifiutarono il piano di spartizione.
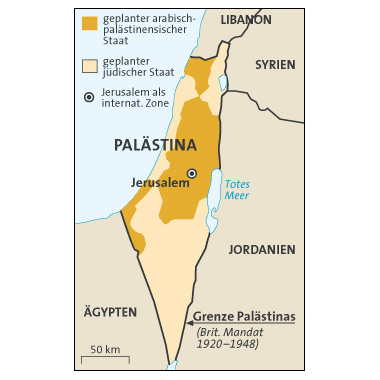
Il giorno successivo alla deliberazione dell’ONU fra i Palestinesi e gli immigrati ebrei cominciò una guerra civile. Dopo che David Ben Gurion il 14 maggio 1948 aveva proclamato l’indipendenza di Israele quella guerra si ampliò in un conflitto fra Stati. Truppe egiziane, giordane, siriane, libanesi e irachene si misero in moto – ufficialmente per aiutare i Palestinesi, ufficiosamente per motivi ben più egoistici. Così la Giordania occupò e si annesse la Cisgiordania. Fra febbraio e luglio 1949 furono stipulati diversi trattati di armistizio. Israele avrebbe potuto mantenere tutti i territori che aveva fino ad allora occupato. Lo Stato Palestinese si perse in lontananza.
Le guerre del 1967 e del 1973
La maggior parte dei problemi, sulla cui soluzione si tratta oggi, risalgono alla Guerra dei Sei Giorni del 1967.
Alla sua vigilia si era giunti a scaramucce sul confine settentrionale di Israele verso la Siria. Il presidente egiziano Abdel Nasser fece entrare il suo esercito nel Sinai demilitarizzato e bloccò l’unico accesso al mare di Israele verso l’Africa e l’Asia. In conseguenza di ciò Israele in brevissimo tempo occupò il Sinai, la striscia di Gaza, amministrata dall’Egitto, le alture del Golan, siriane, e la Cisgiordania annessa dalla Giordania. Il 22 novembre 1967 il Consiglio di sicurezza dell’ONU emise la risoluzione 242, alla quale tutti si richiamano ancor oggi.
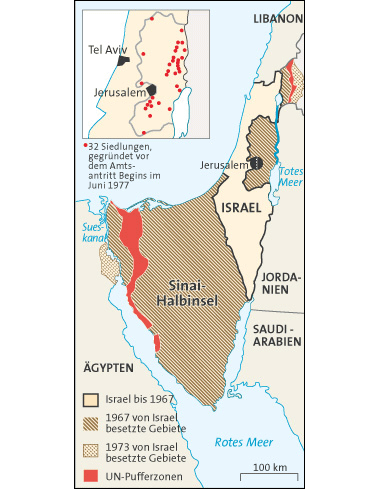
Essa richiedeva il “ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati durante il recente conflitto”, ma richiedeva contemporaneamente anche il rispetto per Israele e per il suo diritto “a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti, libero da minacce e da atti di violenza”. Nel 1973 si arrivò tuttavia ancora una volta alla guerra (Jom Kippur). Alla fine Israele rimase certo il vincitore, ma gli Arabi si sentirono rafforzati. Il 22 ottobre 1973 l’ONU emise la risoluzione 338, che richiedeva alle parti in conflitto “di iniziare senza ritardo con l’applicazione della risoluzione 242 in tutte le sue parti”. Il che vuol dire oggi soprattutto: ritiro da Gaza e dalla Cirgiordania – fino alla linea verde precedente alla Guerra dei Sei giorni del 1967.
1995 – Oslo II
Dopo difficili trattative segrete condotte a Oslo, Israele e il Fronte di Liberazione della Palestina (FLO) firmarono a Washington il 13.9.1933 una cosiddetta dichiarazione di principi, chiamata anche Oslo I.
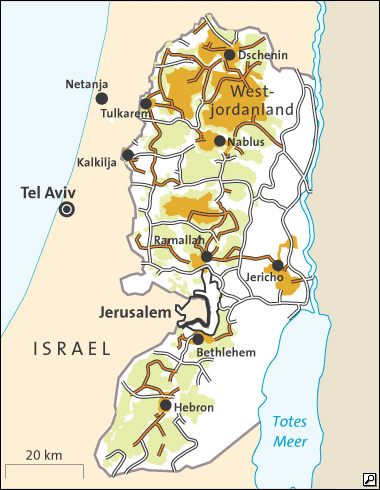
Con essa le parti si danno reciproco riconoscimento, rinunciano alla violenza, e Israele garantisce a parti dei territori da esso occupati uno statuto di autonomia. Secondo l’accordo Gaza-Gerico le forze armate israeliane dovrebbero lasciare Gerico e trasmettere ai Palestinesi il controllo su quasi tutti gli aspetti e i campi della vita pubblica. Ha inizio un tira e molla su numerosi dettagli e quindi già due anni piìù tardi, il 28.9.1995, si sottoscrive a Washington un secondo accordo (Oslo II). L’autonomia amministrativa e di governo dei Palestinesi viene ampliata e la Cisgiordania ripartita in tre zone. La zona A – che raccoglie le grandi città esclusa Hebron – passa sotto il completo controllo dei Palestinesi. La zona B resta sotto amministrazione comune. La zona C – insediamenti ebraici e territori disabitati con basi militari – sta sotto il comando di Israele. Ma gli attacchi terroristici, la costruzione degli insediamenti ebraici e l’Intifada mandano in fumo gli obiettivi dei piani di Oslo: più autonomia per i palestinesi, più sicurezza per gli israeliani.
2000 – Clinton
Se pure gli accordi di Oslo avevano lasciato intenzionalmente da parte l’istituzione di uno Stato palestinese e scottanti problemi come lo statuto di Gerusalemme e la questione dei profughi, i successivi gruppi di discussione (Wye, 1998) e Scharm el-Scheikh 1999) non si discostarono da questa linea. Il presidente degli USA, Bill Clinton, era quasi riuscito a sfondare poco prima della fine del suo mandato. Secondo gli accordi di Camp David e Taba (2000/2001) il futuro Stato palestinese si sarebbe esteso su tutta Gaza e sul 95% della Cisgiordania.
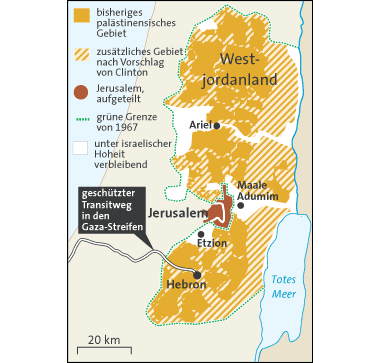
Una arteria di transito doveva congiungere le due parti e Gerusalemme sarebbe stata ripartita. Ma come sempre si litigava su ogni metro e ogni dettaglio. Alla fine anche il piano Clinton fallì: perché Arafat non volle adeguarsi al piano di ripartizione di Gerusalemme. Perché alla fine rimase insoluta la questione delle postazioni militari israeliane sul fiume Giordano, perché insediamenti come Ariel, Maale e Etzion dovevano restare israeliani e Arafat temeva che il suo futuro Stato sarebbe stato un patchwork, frazionato e difficilmente governabile.
2002: Road Map
Nel marzo 2002 il principe ereditario saudita Abdallah si esprime per il riconoscimento di Israele da parte degli Stati arabi, se Israele come contropartita avesse sgomberato tutti i territori occupati e si fosse ritirato sulla linea verde del 1967. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU emana una risoluzione che propugna la creazione di uno Stato palestinese. E il 24 giugno 2002 il presidente degli Stati Uniti Gorge W. Bush annuncia solennemente di sentirsi personalmente impegnato per la pace nel Vicino Oriente e per la soluzione dei Due Stati.
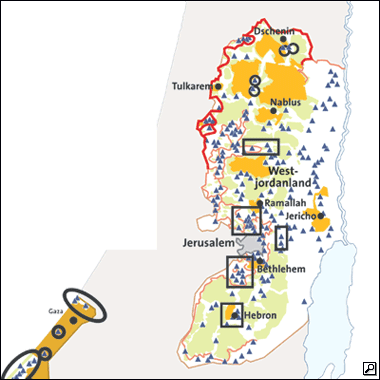
Da tutte queste dichiarazioni sorge una nuova iniziativa di americani, europei, russi e dell’ONU: la Roadmap, la tabella di marcia per la pace. Il suo obiettivo: già nel 2005 dovrebbe esistere uno “Stato palestinese indipendente, vitale, sovrano, in pace e sicurezza, fianco a fianco con Israele. La via per arrivarci: il governo palestinese rinnega la violenza e cessa di esercitarla. Israele termina la costruzione degli insediamenti e demolisce quelli illegali (fase 1). Dopodiché lo Stato palestinese si riforma e indice libere elezioni. Israele ritira gradualmente il suo esercito da Gaza e dalla Cisgiordania (fase 2). Per concludere si trova una soluzione per Gerusalemme, i profughi palestinesi e alcuni grandi insediamenti israeliani (fase 3). Ma già la prima fase naufraga. Adesso Israele si pè deciso ad andare avanti per conto suo, con il sostegno degli americani: sgombero da Gaza e creazione di fatti compiuti in Cisgiordania. Israele vuole assicurarsi grandi insediamenti – e per questo crea dei cunei. La questione quindi rimane aperta: quanto grande, quanto unito, quanto sovrano sarà mai uno Stato palestinese?
2005/2006 – Isolamento e aperto uso della forza
Nel 2005 le forze armate israeliane sgomberano la striscia di Gaza, tutti gli insediamenti vengono sciolti. Il movimento islamico Hamas vince le elezioni nei Territori palestinesi. Inoltre questo non riconosce il diritto all’0esistenza di Israele.
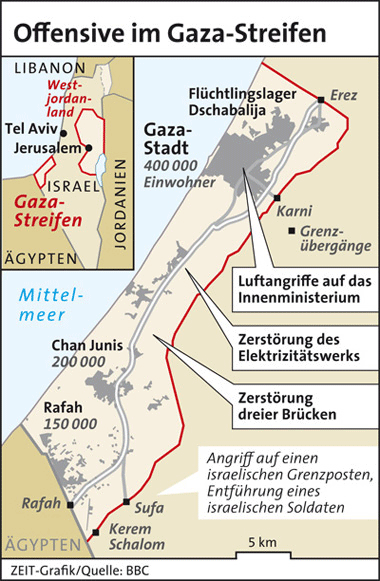
Subito dopo l’Unione Europea toglie al governo palestinese il suo sostegno finanziario e anche altri finanziatori si ritirano. I conflitti fra palestinesi diventano sempre più spesso violenti e gli osservatori avvertono del pericolo di una guerra civile. Anche i toni fra Israele e i Palestinesi diventano sempre più duri; il governo di Ehud Olmert, il successore di Ariel Sharon, si rifiuta di aprire colloqui con la direzione di Hamas. Il 25 giugno 2006 militanti palestinesi aggrediscono un posto di controllo dell’esercito israeliano al confine con la striscia di Gaza e rapiscono il soldato Gilad Shalit. Israele fa intervenire i carri armati, occupa una parte della Striscia e bombarda edifici governativi e parti dell’infrastrutture. Dozzine di funzionari di Hamas, fra i quali anche membri del governo, sono arrestati. Olmert rifiuta seccamente la richiesta dei rapitori di liberare centinaia di reclusi palestinesi in cambio di Shalit. Il 12 luglio 2006 alcuni commando della milizia sciita Hezbollah rapiscono due soldati israeliani da un carro armato che era stato circondato durante una scaramuccia sul confine libanese. Questo rapimento ha scatenato la nuova guerra del Libano.
Testo originale:
© ZEIT online 18.7.2006 - 17:29 Uhr
60 Jahre Kampf
Kriege, Siedlungen, Grenzen, immer wieder neue Anläufe zum Frieden - und dann doch wieder Gewalt. Eine kleine Geschichte des Nahost-Konfliktes Von Martin Klingst und Karsten Polke-Majewski
2006 – Krieg im Libanon
Wieder einmal überschlagen sich die Ereignisse in Nahen Osten, und nicht zum Guten. Israelische Flugzeuge bombardieren Vororte von Beirut, auch die Autobahn zwischen der libanesischen Hauptstadt und Damaskus wird beschossen. Die Marine hat die Seewege in den Libanon abgeriegelt. Im Gegenzug feuert die schiitische Hisbollah-Miliz Raketen immer tiefer in das israelische Kernland – zuletzt bis in die Hafenstadt Haifa.
Während die militärischen Auseinandersetzungen eskalieren, wird der Ton der beteiligten Staatsführer stetig schärfer. Israels Ministerpräsident Ehud Olmert spricht von einer Kriegserklärung Libanons, weil dessen Regierung die Hisbollah nicht aufhält. Irans Präsident Mahmud Ahmadineschad warnt Israel davor, Syrien anzugreifen und droht mit harten Reaktionen. In der syrischen Hauptstadt haben sowohl die Hisbollah wie die islamistische palästinensische Hamas ihre Zentralen. Ein regionaler Krieg droht. Worin liegen die Ursachen dieses nun schon seit mehr als sechzig Jahren nicht zur Ruhe kommenden Konflikts? Ein historischer Überblick.
1947 – UN-Teilungsplan
Nach langen, turbulenten Verhandlungen rief die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 29. November 1947 zur Teilung des britischen Mandatsgebiets Palästina auf. Wörtlich heißt es in der UN-Resolution 181: "Unabhängige arabische und jüdische Staaten sowie das Besondere Internationale Regime für den Stadtbezirk von Jerusalem sollen, zwei Monate nachdem der Abzug der Streitkräfte der Mandatsmacht beendet worden ist, auf jeden Fall nicht später als am 1. Oktober 1948, zur Existenz gelangen. Die Grenzen des arabischen Staates und des jüdischen Staates sowie des Stadtbezirks von Jerusalem sollen verlaufen wie weiter unten in Teil II und Teil III beschrieben." Die UN-Resolution regelte nicht nur den exakten Grenzverlauf, sondern auch die Staatsangehörigkeiten, Transitwege, die religiösen und bürgerlichen Rechte. Die arabischen Regierungen und die Palästinenser lehnten den Teilungsplan ab.
Einen Tag nach dem UN-Beschluss begann zwischen Palästinensern und jüdischen Einwanderern ein Bürgerkrieg. Nachdem David Ben Gurion am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit Israels ausgerufen hatte, weitete sich dieser Bürgerkrieg in einen zwischenstaatlichen Konflikt aus. Ägyptische, jordanische, syrische, libanesische und irakische Truppen marschierten ein – offiziell, um den Palästinensern zu helfen, inoffiziell aber auch aus sehr eigennützigen Gründen. So eroberte und annektierte Jordanien das Westjordanland. Zwischen Februar und Juli 1949 wurden verschiedene Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Israel durfte alle Gebiete behalten, die es bis dahin erobert hatte. Der palästinensische Staat rückte in weite Ferne.
1967 und 1973 - Kriege
Die meisten Probleme, über deren Lösung heute verhandelt wird, gehen auf den Sechs-Tage-Krieg von 1967 zurück. Im Vorfeld war es zu Scharmützeln an Israels Nordgrenze zu Syrien gekommen. Ägyptens Präsident Abdel Nasser ließ seine Armee in den demilitarisierten Sinai einrücken und blockierte Israels einzigen Meereszugang in Richtung Afrika und Asien. Daraufhin eroberte Israel innerhalb kürzester Zeit den Sinai, den von Ägypten verwalteten Gaza-Streifen, die syrischen Golanhöhen und das von Jordanien annektierte Westjordanland. Am 22. November 1967 beschloss der UN-Sicherheitsrat die Resolution 242, auf die sich heute noch alle berufen. Sie verlangt den "Rückzug israelischer Streitkräfte aus Gebieten, die während des jüngsten Konflikts besetzt wurden", aber fordert ebenso die Achtung Israels und seines Rechts, "innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen in Frieden zu leben frei von Drohungen und Akten der Gewalt". 1973 kam es abermals zum Krieg (Jom Kippur). Am Ende blieb Israel zwar siegreich, doch die Araber fühlten sich gestärkt. Am 22. Oktober 1973 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 338, die alle Konfliktparteien auffordert, "unverzüglich mit der Erfüllung der Resolution 242 in allen ihren Bestandteilen zu beginnen". Aufgabe der besetzten Gebiete heißt heute meist: Rückzug aus Gaza und dem Westjordanland - bis an die grüne Linie vor dem Sechs-Tage-Krieg von 1967.
1995 – Oslo II
Nach schwierigen, geheimen Verhandlungen in Oslo unterzeichneten Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) am 13.9.1993 in Washington eine so genannte Prinzipienerklärung, auch Oslo I genannt. Darin erkennen sich beide Parteien an, verzichten auf Gewalt, und Israel gewährt Teilen des von ihm besetzten Gebietes einen Autonomiestatus. Nach dem Gaza-Jericho-Abkommen sollen die israelischen Streitkräfte Gaza und Jericho verlassen und den Palästinensern die Kontrolle über nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens übertragen. Es beginnt ein Gezerre um viele Details, doch schon zwei Jahre später, am 28.9.1995 wird in Washington ein zweites Abkommen (Oslo II) unterschrieben. Die Selbstverwaltung der Palästinenser wird ausgeweitet, das Westjordanland in drei Zonen aufgeteilt. Die Zone A - sie umfasst die großen Städte mit Ausnahme Hebrons - wird vollständig von den Palästinensern kontrolliert. Die Zone B steht unter gemeinsamer Regie. Die Zone C - jüdische Siedlungen und unbewohntes Gebiet mit Militärstützpunkten - steht unter dem Kommando Israels. Doch Terroranschläge, Siedlungsbau und Intifada machen das Ziel der Oslo-Pläne zunichte: mehr Autonomie für die Palästinenser, mehr Sicherheit für die Israelis.
2000 – Clinton
Hatte Oslo die Errichtung eines palästinensischen Staates und heikle Fragen wie den Status von Jerusalem und die Flüchtlingsfrage noch gezielt ausgeklammert, so drückten sich die nächsten Gesprächsrunden (Wye 1998, Scharm al-Scheich 1999) nicht davor. US-Präsident Bill Clinton wäre kurz vor dem Ende seiner Amtszeit fast der Durchbruch gelungen. Nach den Verhandlungen von Camp David und Taba (2000/01) sollte sich der künftige Staat Palästina über ganz Gaza und über 95 Prozent des Westjordanlands ausbreiten. Ein Transitweg sollte beide Teile verbinden und Jerusalem aufgeteilt werden. Aber wie immer stritt man über jeden Meter und jedes Detail. Am Ende scheiterte auch der Clinton-Plan: Weil Arafat sich über die Teilung Jerusalems nicht einigen wollte. Weil letztlich die Frage israelischer Militärstellungen am Jordan-Fluss ungeklärt blieb, weil Siedlungen wie Ariel, Maale Adumim und Etzion bei Israel verbleiben sollten und Arafat befürchtete, sein künftiger Staat bliebe damit ein Flickenteppich, aufgeteilt und schwer regierbar.
2002 – Road Map
Im März 2002 spricht sich der saudische Kronprinz Abdallah für die Anerkennung Israels durch die arabischen Staaten aus, falls Israel im Gegenzug alle besetzten Gebiete räumt und sich auf die grüne Linie von 1967 zurückzieht. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet eine Resolution, die die Schaffung eines palästinensischen Staates befürwortet. Und am 24. Juni 2002 verkündet US-Präsident George W. Bush feierlich, er fühle sich dem Frieden im Nahen Osten und einer Zwei-Staaten-Lösung persönlich verpflichtet. Aus all diesen Erklärungen erwächst eine neue Initiative der Amerikaner, Europäer, Russen und der UN: Die Roadmap, der Fahrplan zum Frieden. Ihr Ziel: 2005 schon soll ein „unabhängiger, lebensfähiger, souveräner palästinensischer Staat in Frieden und Sicherheit Seite an Seite mit Israel“ existieren. Der Weg dorthin: Die palästinensische Regierung schwört der Gewalt ab und stoppt sie. Israel beendet den Siedlungsausbau und reißt illegale Außenposten ein (Phase 1). Sodann reformiert sich der palästinensische Staat und hält freie Wahlen ab. Israel zieht allmählich sein Militär aus Gaza und dem Westjordanland ab (Phase 2). Zum Schluss wird eine Lösung für Jerusalem, die palästinensischen Flüchtlinge und einige israelische Großsiedlungen gefunden (Phase 3). Doch schon die erste Phase scheitert. Jetzt hat sich Israel mit amerikanischer Unterstützung zum Alleingang entschieden: Räumung von Gaza und Schaffung vollendeter Tatsachen im Westjordanland. Große Siedlungen will Israel sich einverleiben – und bildet damit Keile. Die Frage also bleibt: Wie groß, wie zusammenhängend, wie souverän wird ein Palästinenserstaat jemals sein?
2005/2006 Isolation und offene Gewalt
2005 räumte die israelische Armee den Gaza-Streifen, alle Siedlungen wurden aufgelöst. Bei den Wahlen in den Palästinensergebieten gewann die islamistische Hamas die Mehrheit. Weiterhin erkannte sie das Existenzrecht Israels nicht an. Daraufhin entzog die Europäische Union der Palästinenserregierung ihre finanzielle Unterstützung, auch andere Geldgeber hielten sich zurück. Innerpalästinensische Konflikte wurden immer öfter gewaltsam ausgetragen, Beobachter warnten vor einem Bürgerkrieg. Auch der Ton zwischen Israelis und Palästinensern wurde zunehmend schärfer; die Regierung Ehud Olmerts, des Nachfolgers von Ariel Scharon, weigerte sich, Gespräche mit der Hamas-Führung zu führen. Am 25. Juni 2006 überfielen militante Palästinenser einen Kontrollposten der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen und verschleppten den Soldaten Gilad Shalit. Israel ließ Panzer auffahren, besetzte Teile des Streifens und bombardierte Regierungsgebäude sowie Teile der Infrastruktur. Dutzende Hamas-Funktionäre, darunter auch Regierungsmitglieder, wurden festgenommen. Die Forderung der Entführer, im Austausch gegen Shalit Hunderte palästinensische Gefangene freizulassen, wies Olmert scharf zurück. Am 12. Juli 2006 entführte ein Kommando der schiitischen Hisbollah-Miliz zwei israelische Soldaten aus einem Panzer, der in ein Scharmützel an der libanesisch-israelischen Grenze verwickelt war. Diese Entführung löste den neuen Libanon-Krieg aus.
Krieg im Libanon:
Nachrichten, Analysen, Hintergründe »
© ZEIT-Grafik
© ZEIT online 18.7.2006 - 17:29 Uhr
Venerdì, 21 luglio 2006